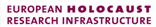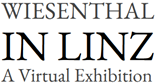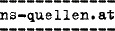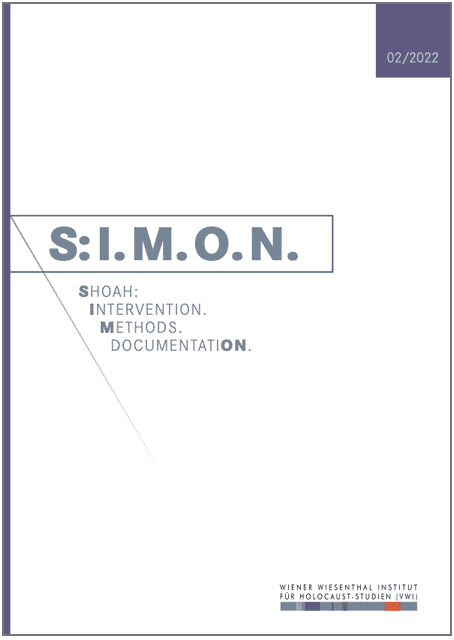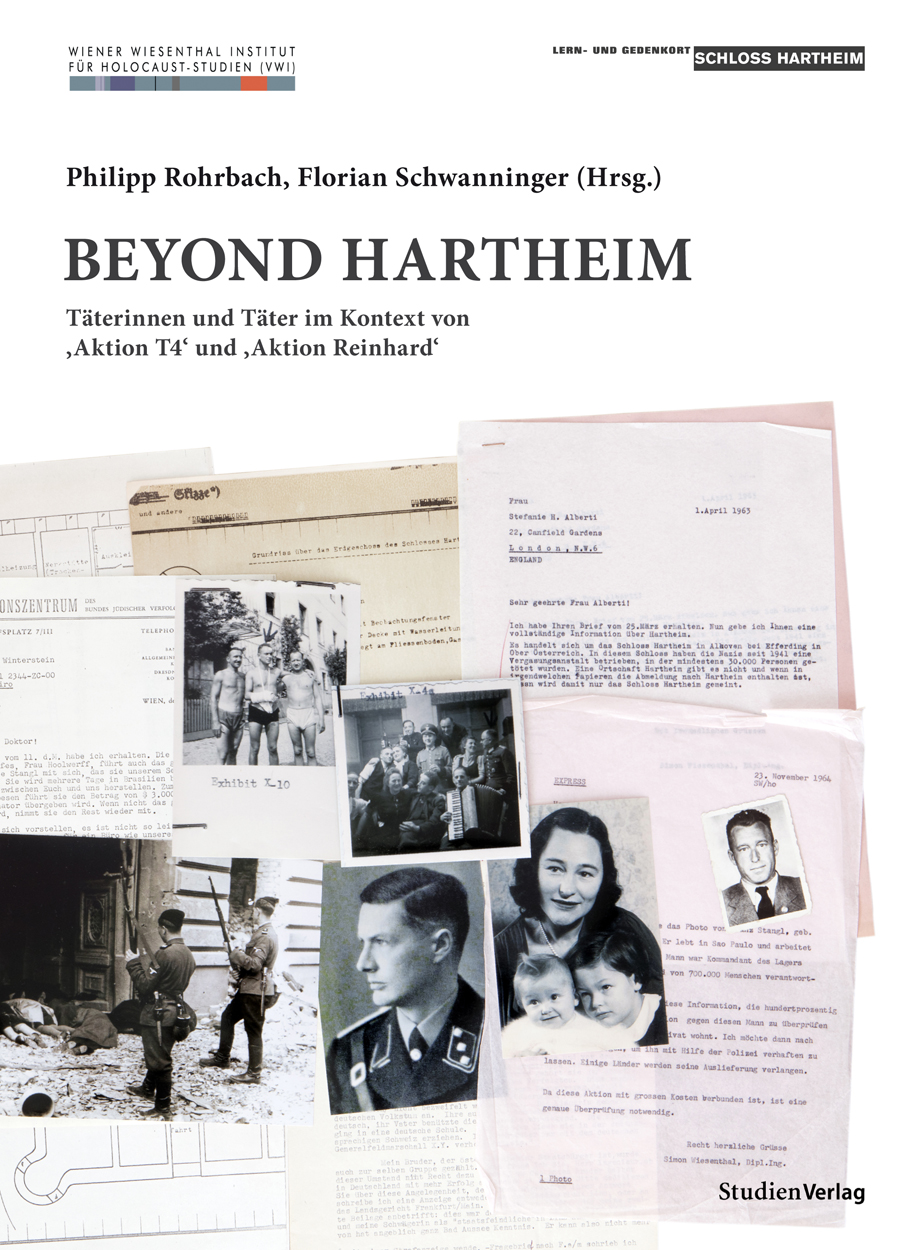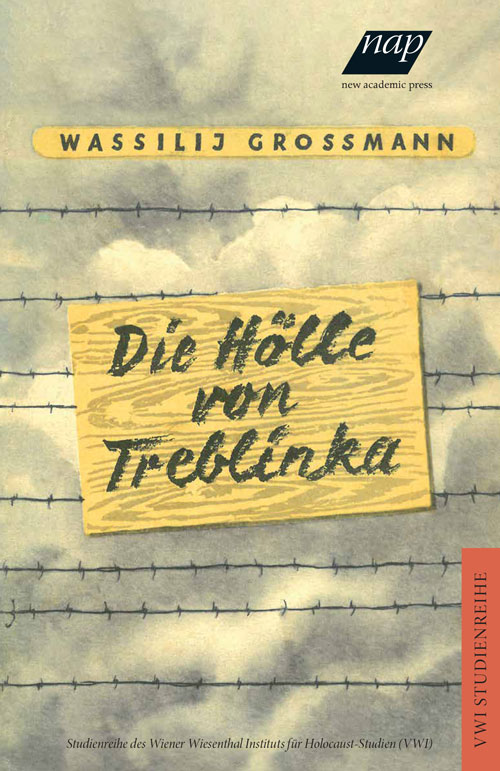News – Veranstaltungen – Calls
| 02. Mai 2024 18:30 Simon Wiesenthal LectureEdyta Gawron: Never Too Late to Remember, Never Too Late for Justice! Holocaust Research and Commemoration in Contemporary PolandIn 1994, Simon Wiesenthal received a doctorate honoris causa from the Jagiellonian University in Krakow for his lifelong quest for justice – half a century after he had been, for a short time, prisoner of the local Nazi Concentration Camp (KL) Plaszow. The 1990s were the decade when t...Weiterlesen... |
| 07. Mai 2024 00:00 - 04. Juni 2024 00:00 WorkshopDealing with Antisemitism in the Past and Present. Scientific Organisations and the State of Research in AustriaThis series of talks, presented by antisemitism experts from different organisations that research antisemitism using a variety of academic approaches, aims to provide a snapshot of historical evolutions, current events, prevalent perceptions and declared (and undeclared) attitudes. I...Weiterlesen... |
| 14. Mai 2024 08:45 - 16. Mai 2024 16:30 TagungQuantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling: What Contribution to Holocaust History? About the conference: https://quantiholocaust.sciencesconf.org/ Programme timed on the basis of 15-minute presentations + 15-minute discussions; short breaks and lunches Day 1 Tuesday, 14 May 2024Centre Malher (9 rue Malher 75004 Paris/amphi Dupuis) From 8.45 am: Welcome9.30 am...Weiterlesen... |
| 24. Mai 2024 18:00 InterventionLange Nacht der Forschung 20242024 öffnet das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) in der Langen Nacht der Forschung wieder seine Tore und lädt Interessierte in seine Räumlichkeiten am Rabensteig 3 ein. Im Rahmen von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Präsentationen bieten VWI-Team und Gäste Einb...Weiterlesen... |
| 04. Juni 2024 13:00 VWI invites/goes to...Workshop: Social History of the Shoah. Everyday Life, Space and Time VWI invites the Department of Contemporary History, University of Vienna 13:00Hannah Riedler (VWI Junior Fellow)Between Deportation, Forced Labour and Germanisation. The Umwandererzentralstelle in Occupied Poland 1939–1941Commented by Kerstin von Lingen 13:40...Weiterlesen... |
| 13. Juni 2024 18:30 Simon Wiesenthal LectureJack Fairweather: The Trials of Fritz Bauer. How Life as a Gay Jewish Socialist under the Nazis Shaped His Quest for JusticeFritz Bauer’s daring mission to bring Adolf Eichmann and the perpetrators of Auschwitz to justice forced Germany and the world to pay attention to the crimes of the Holocaust. Bauer’s moral courage in speaking out in a society that had not yet come to terms with its past, which he him...Weiterlesen... |
Judith Szapor
Senior Fellow (01/2018–05/2018)
Gender, Rasse und jüdische Familie in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg. Frauen und der Numerus Clausus 1919–1928
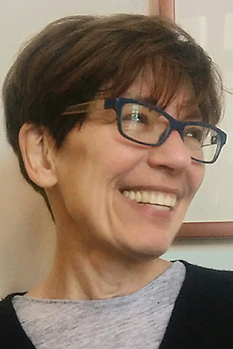 Im September 1920 verabschiedet, beschränkte das ungarische Numerus-Clausus-Gesetz den Zugang von Jüdinnen und Juden zu den Universitäten auf sechs Prozent aller Studierenden, den prozentualen Anteil der jüdischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung des Landes. Jüdische Frauen waren von diesem Gesetz überproportional betroffen, einerseits wegen des nun de facto bis 1923 gültigen Immatrikulationsverbots für Frauen, andererseits wegen des hohen Anteils von jüdischen Studentinnen an den Universitäten Ungarns vor dem Ersten Weltkrieg. Die juristische und politische Geschichte des Gesetzes, das – indem es das Prinzip der staatsbürgerlichen Gleichheit untergrub – den Boden für den Holocaust bereitete, ist inzwischen weitestgehend bekannt. Untersuchungen zu den sogenannten Numerus-Clausus-Flüchtlingen, zu jenen Studierenden, die Ungarn verließen, um in Österreich, Deutschland, der Tschechoslowakei oder anderswo zu studieren, liegen ebenfalls schon vor.
Im September 1920 verabschiedet, beschränkte das ungarische Numerus-Clausus-Gesetz den Zugang von Jüdinnen und Juden zu den Universitäten auf sechs Prozent aller Studierenden, den prozentualen Anteil der jüdischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung des Landes. Jüdische Frauen waren von diesem Gesetz überproportional betroffen, einerseits wegen des nun de facto bis 1923 gültigen Immatrikulationsverbots für Frauen, andererseits wegen des hohen Anteils von jüdischen Studentinnen an den Universitäten Ungarns vor dem Ersten Weltkrieg. Die juristische und politische Geschichte des Gesetzes, das – indem es das Prinzip der staatsbürgerlichen Gleichheit untergrub – den Boden für den Holocaust bereitete, ist inzwischen weitestgehend bekannt. Untersuchungen zu den sogenannten Numerus-Clausus-Flüchtlingen, zu jenen Studierenden, die Ungarn verließen, um in Österreich, Deutschland, der Tschechoslowakei oder anderswo zu studieren, liegen ebenfalls schon vor.
Allein Arbeiten über die spezifischen Erfahrungen von Frauen oder gar über die genaue Zahl derer, die von diesem Gesetz betroffen waren, gibt es bis heute nicht. Das Projekt wird daher archivalische und mündlich überlieferte historische Quellen heranziehen, um die sozialen und geschlechtsspezifischen historischen Aspekte dieses Phänomens näher zu beleuchten. Auch die durch dieses Phänomen bedingten individuellen und familiären Strategien sowie die Auswirkungen auf Lebensentscheidungen, wie Verehelichung oder Emigration, werden erörtert.
Judith Szapor ist Assistant Professor für moderne europäische Geschichte an der McGill University, Montreal. Zu ihren Veröffentlichungen gehören u.a. Jewish Intellectual Women in Central Europe 1860-2000. Twelve Biographical Essays, Lewiston, N.Y. u.a. 2012 (gemeinsam mit Andrea Pető, Maura Hametz, and Marina Calloni) sowie die vor der Drucklegung stehende Monografie Hungarian Women’s Activism in the Wake of the First World War. From Rights to Revanche.
Daniel Cohen
Senior Fellow (09/2018–12/2018)
‚Philosemitismus’ in Europa nach dem Holocaust. 1945 bis heute
 Mit 1945 und unmittelbar nach dem Holocaust tauchten in Westeuropa und – nach ihrer Gründung – in der EU verschiedenste Formen eines theologischen, politischen und kulturellen ‚Philosemitismus’ in den entscheidenden öffentlichen Diskursen auf. Cohens in Arbeit befindliches Buch wird eine kritische Geschichte dieser tragenden ‚philosemitischen’ Tropen sein, in denen Jüdinnen und Juden, das Judentum und jüdische Identität im Gefolge der Katastrophe positiv imaginiert wurden: Humanismus und Antifaschismus in den späten 1940er-Jahren, Philo-Zionismus in den 1950er-Jahren, die große Rebellion der sechziger Jahre, Trauma und Bürgerrechtsbewegung in den Siebzigern, die Wiederentdeckung ‚Mitteleuropas’ in den 1980er-Jahren, die Wiederauferstehung des toten, nun ‚kosmopolitischen’ Juden in der Imagination der Europäischen Union und schließlich – noch verstörender – der zurzeit laufende Einsatz des ‚Philosemitismus’ im Namen eines angeblich bedrohten jüdisch-christlichen Europas.
Mit 1945 und unmittelbar nach dem Holocaust tauchten in Westeuropa und – nach ihrer Gründung – in der EU verschiedenste Formen eines theologischen, politischen und kulturellen ‚Philosemitismus’ in den entscheidenden öffentlichen Diskursen auf. Cohens in Arbeit befindliches Buch wird eine kritische Geschichte dieser tragenden ‚philosemitischen’ Tropen sein, in denen Jüdinnen und Juden, das Judentum und jüdische Identität im Gefolge der Katastrophe positiv imaginiert wurden: Humanismus und Antifaschismus in den späten 1940er-Jahren, Philo-Zionismus in den 1950er-Jahren, die große Rebellion der sechziger Jahre, Trauma und Bürgerrechtsbewegung in den Siebzigern, die Wiederentdeckung ‚Mitteleuropas’ in den 1980er-Jahren, die Wiederauferstehung des toten, nun ‚kosmopolitischen’ Juden in der Imagination der Europäischen Union und schließlich – noch verstörender – der zurzeit laufende Einsatz des ‚Philosemitismus’ im Namen eines angeblich bedrohten jüdisch-christlichen Europas.
G. Daniel Cohen ist Associate Professor für Geschichte und Jüdische Studien an der Rice University in Houston, Texas. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Geschichte von Flucht und Zwangsumsiedlung im Europa des zwanzigsten Jahrhunderts. Zurzeit arbeitet er an einer kritischen Geschichte des ‘Philosemitismus’ in Westeuropa seit 1945 bzw. seit der Gründung der EU.
Gerald J. Steinacher
Senior Fellow (1/2021–6/2021)
Vergeben und vergessen? Der Vatikan und die Nürnberger Prozesse 1945–1955
 Papst Pius XII., seine engsten Berater sowie zahlreiche Kardinäle und Bischöfe standen den Nürnberger Prozessen sowie dem gesamten Entnazifizierungsprojekt in Deutschland äußerst kritisch gegenüber. Man hinterfragte die Bemühungen der Alliierten – nicht zuletzt jene der US-AmerikanerInnen – NS-TäterInnen den Prozess zu machen. Die Interventionen des Vatikans liefen schließlich auf Forderungen nach einer allgemeinen Amnestie hinaus.
Papst Pius XII., seine engsten Berater sowie zahlreiche Kardinäle und Bischöfe standen den Nürnberger Prozessen sowie dem gesamten Entnazifizierungsprojekt in Deutschland äußerst kritisch gegenüber. Man hinterfragte die Bemühungen der Alliierten – nicht zuletzt jene der US-AmerikanerInnen – NS-TäterInnen den Prozess zu machen. Die Interventionen des Vatikans liefen schließlich auf Forderungen nach einer allgemeinen Amnestie hinaus.
Das Forschungsprojekt untersucht grundsätzliche Fragen zu Schuld und Verantwortung, die einen Vergleich unterschiedlicher und konkurrierender Modelle von transitional justice gestatten. Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Wieso kritisierte die Führung der katholischen Kirche die Verurteilung von KriegsverbrecherInnen durch die Strafjustiz so vehement? Welche möglichen Alternativen boten der Vatikan und insbesondere der Papst, um mit Schuld und Verantwortung umzugehen? Gab es auch dort Konzepte für eine transitional justice?
In der unmittelbaren Nachkriegszeit betrachteten viele Menschen Papst Pius XII. als herausragende moralische Instanz. Österreich und Italien sowie ein Großteil von Deutschland waren überwiegend katholisch. Aber auch in anderen Teilen des südlichen und westlichen Europas übte die katholische Kirche großen Einfluss auf die Öffentlichkeit aus. Die Haltung der katholischen Kirche gegenüber einer ‚gerechten’ Strafe für Verbrechen der ehemaligen faschistischen Regime ist ein besonderer Aspekt für das Verständnis dieser Gesellschaften und der moralischen Grundhaltung in dieser Zeit.
Gerald J. Steinacher ist James A. Rawley Professor für Geschichte an der University of Nebraska-Lincoln und wird im Zeitraum von Jänner bis Juni 2021 als Senior Fellow am VWI tätig sein. Er hat zahlreiche Publikationen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts in Deutschland, Österreich und Italien vorgelegt, zuletzt Humanitarians at War. The Red Cross in the Shadow of the Holocaust (Oxford 2017), und Nazis on the Run. How Hitler’s Henchmen Fled Justice (Oxford 2011).
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Péter Apor
Senior Fellow (03/2022-08/2022)
Antisemitismus und kollektive Gewalt in Ungarn nach 1945
 Meine Forschung untersucht die Genese und die Konsequenzen kollektiver Gewalt von Seiten der Arbeiter und Bauern in Ungarn nach 1945. Dabei konzentriere ich mich auf vier Subthemen: 1, die Idee „legitimer Gewalt“ in der Populärkultur der Nachkriegszeit; 2, die öffentliche Wahrnehmung von Juden sowie des Holocaust nach 1945; 3, das Populärgedächtnis des Krieges und; 4, die politischen Indienstnahmen dieser Pogrome.
Meine Forschung untersucht die Genese und die Konsequenzen kollektiver Gewalt von Seiten der Arbeiter und Bauern in Ungarn nach 1945. Dabei konzentriere ich mich auf vier Subthemen: 1, die Idee „legitimer Gewalt“ in der Populärkultur der Nachkriegszeit; 2, die öffentliche Wahrnehmung von Juden sowie des Holocaust nach 1945; 3, das Populärgedächtnis des Krieges und; 4, die politischen Indienstnahmen dieser Pogrome.
Meine Forschungen werden einerseits zu einem besseren Verständnis der sozial-politischen Geschichte der Umwälzungen und Transformation in Osteuropa nach 1945 beitragen, und andererseits ebenso Einsichten in die Genese kollektiver Gewalt generieren, die auch für die breiteren Sozialwissenschaften von Interesse sind.
Péter Apor ist Senior Research Fellow am Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Zwischen 2003 und 2011 war Apor Research Fellow an der Central European University (Budapest) und an der Universität Exeter assoziiert. Von 2015 bis 2018 war er Koordinator eines durch die Gerda Henkel Stiftung geförderten Forschungsprojekts, das in vergleichender Perspektive antisemitische Pogrome in Osteuropa nach 1945 aufgearbeitet hat. Seine Forschungsinteressen umfassen Erinnerungs- und Geschichtspolitik nach 1945 in Ost- und Zentraleuropa, Mechanismen kollektiver Gewalt sowie die Geschichte des Imperialismus und Kolonialismus im Kalten Krieg. Apor ist der Mitherausgeber von The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe, Budapest, 2018. Er ist der Autor des Buches Fabricating Authenticity in Soviet Hungary: The Afterlife of the First Hungarian Soviet Republic in the Age of State Socialism, Anthem Press, London, 2014.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Noah Shenker
Senior Fellow (01/2022-07/2022)
Jenseits der Ära der Zeugenschaft: Das digitale Nachleben des Holocaust
 Die „Ära der Zeugenschaft“, in der die Erinnerung von Überlebenden durch Filme, Zeugenaussagen und andere Medien konsolidiert wurden, verändert sich grundlegend durch einen Generationenwechsel, der bewirkt, dass die ZeitzeugInnen (bald) nicht mehr selbst sprechen und Repräsentationen des Holocaust durch ihre unmittelbare Anwesenheit nicht mehr dieselbe lebensweltliche, moralische Autorität beanspruchen können. Das Dimensions in Testimony Projekt (DiT) der USC Shoah Foundation begegnet dieser Herausforderung mittels Motion-Capture-Technologie, intensiviert geführten Interviews, und datenbankbasierter AI, um eine Sammlung frei verfügbarer, interaktiver virtueller ZeitzeugInnen zu erstellen. In meinem jüngsten Buchprojekt bieten wir ForscherInnen, AktivistInnen, KuratorInnen einen Rahmen für die Arbeit an und mit sowie die Interpretation von DiT und anderen digitalen Repräsentationen des Holocaust. Es zeigt sich, dass Initiativen wie DiT auf eine tradierte Genealogie der Automata und des virtuellen Menschen rekurrieren. Aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet, erscheinen die DiT Avatare nicht nur als aussagende ZeugInnen, sondern als virtuelle Pädagogik-Agenten, die im breiteren Kontext des interaktiven Lernens zu verorten sind, das sich bisweilen im Grenzbereich zum Eventhaften bewegt.
Die „Ära der Zeugenschaft“, in der die Erinnerung von Überlebenden durch Filme, Zeugenaussagen und andere Medien konsolidiert wurden, verändert sich grundlegend durch einen Generationenwechsel, der bewirkt, dass die ZeitzeugInnen (bald) nicht mehr selbst sprechen und Repräsentationen des Holocaust durch ihre unmittelbare Anwesenheit nicht mehr dieselbe lebensweltliche, moralische Autorität beanspruchen können. Das Dimensions in Testimony Projekt (DiT) der USC Shoah Foundation begegnet dieser Herausforderung mittels Motion-Capture-Technologie, intensiviert geführten Interviews, und datenbankbasierter AI, um eine Sammlung frei verfügbarer, interaktiver virtueller ZeitzeugInnen zu erstellen. In meinem jüngsten Buchprojekt bieten wir ForscherInnen, AktivistInnen, KuratorInnen einen Rahmen für die Arbeit an und mit sowie die Interpretation von DiT und anderen digitalen Repräsentationen des Holocaust. Es zeigt sich, dass Initiativen wie DiT auf eine tradierte Genealogie der Automata und des virtuellen Menschen rekurrieren. Aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet, erscheinen die DiT Avatare nicht nur als aussagende ZeugInnen, sondern als virtuelle Pädagogik-Agenten, die im breiteren Kontext des interaktiven Lernens zu verorten sind, das sich bisweilen im Grenzbereich zum Eventhaften bewegt.
Noah Shenker is der 6a Foundation und N. Milgrom Senior Lecturer in Holocaust und Genozid Studien am Australian Centre for Jewish Civilisation der Monash University in Melbourne. Er ist der Autor des Buches Reframing Holocaust Testimony (Indiana University Press, 2015) und hat zahlreiche Artikel und Kapitel zum Thema der Holocaust-Repräsentation im Film und den Neuen Medien verfasst. Zurzeit arbeitet er gemeinsam mit Dan Leopard an einer Monografie mit dem Titel Beyond the Era of the Witness: The Digital Afterlife of Holocaust Testimony.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Corry Guttstadt
Senior Fellow (02/2021–07/2021)
Islamisch motivierter Antisemitismus in und aus der Türkei – Themen, Argumentationsmuster und Verbreitung
 Islamischer Antisemitismus ist eines der in der europäischen Öffentlichkeit am meisten diskutierten Themen. Allerdings ist die Debatte häufig politisch motiviert und stark ideologisiert: Während die eine Seite ‚den Muslimen’ generell antisemitische Einstellungen und Motive unterstellt, beschwört die Gegenseite gern die ‚islamische Toleranz’ und die sichere Existenz, die Juden etwa im Osmanischen Reich deshalb über Jahrhunderte genossen hätten. Bislang fehlt allerdings eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung über Herkunft, Häufigkeit und Muster antisemitischer Äußerungen islamisch-religiöser Institutionen in der Türkei.
Islamischer Antisemitismus ist eines der in der europäischen Öffentlichkeit am meisten diskutierten Themen. Allerdings ist die Debatte häufig politisch motiviert und stark ideologisiert: Während die eine Seite ‚den Muslimen’ generell antisemitische Einstellungen und Motive unterstellt, beschwört die Gegenseite gern die ‚islamische Toleranz’ und die sichere Existenz, die Juden etwa im Osmanischen Reich deshalb über Jahrhunderte genossen hätten. Bislang fehlt allerdings eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung über Herkunft, Häufigkeit und Muster antisemitischer Äußerungen islamisch-religiöser Institutionen in der Türkei.
Im Forschungsvorhaben werden die Argumentationsmuster des türkischen Präsidiums für Religionsangelegenheiten (Diyanet İşleri Başkanlığı) sowie die führender islamisch-theologischer Fakultäten gegenüber Juden untersucht. Das Diyanet ist die dem türkischen Staatspräsidenten direkt unterstellte Institution zur Verwaltung religiöser Einrichtungen, die durch die Erstellung von Freitagspredigten, Rechtsgutachten und eigenen Publikationen die Interpretation des Islam in der Türkei und in den ihr unterstellten Moscheen im Ausland wesentlich prägt.
In einem ersten Schritt werden die Stellungnahmen des Diyanet İşleri Başkanlığı und die Publikationen islamisch-theologischer Fakultäten zum Thema „Juden“ in quantitativer Hinsicht mit dem Fokus auf negative Darstellungen ausgewertet. In einem zweiten Schritt werden die Resultate qualitativ hinsichtlich verwendeter Topoi analysiert. Dabei wird insbesondere untersucht, welche Rolle explizit islamisch-religiöse Motive spielen. Schließlich soll die Rezeption antisemitischer Stellungnahmen in türkischen Medien und dem Diyanet unterstellten Institutionen untersucht werden.
Corry Guttstadt ist Turkologin und Historikerin, sie promovierte an der Universität Hamburg. Ihre Dissertation „Die Türkei, die Juden und der Holocaust“ ist ein international anerkanntes Standardwerk. Schwerpunkte ihrer Forschung sind die Lage der Minderheiten in der Türkei, Antisemitismus und die Geschichte der sephardischen Juden. Zahlreich sind ihre Publikationen zur Politik der neutralen Staaten während des Holocaust, zur Situation der sephardischen Juden, Minderheiten in der Türkei und Antisemitismus verfasst. Sie ist Geschäftsführerin des Türkei-Europa-Zentrums (TEZ) an der Universität Hamburg.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Lisa Silverman
Senior Fellow (10/2019–03/2020)
Der Nachkriegsantisemit. Kultur und Mittäterschaft in Österreich und Deutschland 1945–1965
 Untersucht wird die Entwicklung der Darstellungen des Antisemiten in Texten, Gerichtsverhandlungen und visueller Kultur nach 1945. Diese Figur wurde zu einer unverzichtbaren Trope der Nachkriegskultur, die es Österreichern und Deutschen ermöglichte, jegliche Komplizenschaft am Holocaust zu leugnen, sich in einer radikal veränderten politischen und kulturellen Landschaft zu orientieren und ihr – im Nachkrieg auf den Kopf gestelltes – Leben neu aufzustellen. Als eine einfach erkennbare und leicht adaptierbare Figur des Bösen, ersetzte der Antisemit häufig den figurativen Juden, den ultimativen Anderen der europäischen Vorkriegskultur. Dennoch signalisierte diese Ersetzung weder den Wunsch, Juden in die Nachkriegsgesellschaft zu integrieren noch eine Entkräftung der weitverbreiteten und systemischen antisemitischen Vorurteile. Vielmehr im Gegensatz, hob diese Ersetzung nur noch mehr hervor, wie nach dem Holocaust geschaffene Narrative weiter auf tief verwurzelte Tropen von ‚Jewish Difference‘ aufbauten – selbst wenn sie den Antisemitismus explizit ablehnten. Die schädlichen Auswirkungen dieses figurativen Antisemitismus breiteten sich weit über Europa hinaus und dauern bis heute an.
Untersucht wird die Entwicklung der Darstellungen des Antisemiten in Texten, Gerichtsverhandlungen und visueller Kultur nach 1945. Diese Figur wurde zu einer unverzichtbaren Trope der Nachkriegskultur, die es Österreichern und Deutschen ermöglichte, jegliche Komplizenschaft am Holocaust zu leugnen, sich in einer radikal veränderten politischen und kulturellen Landschaft zu orientieren und ihr – im Nachkrieg auf den Kopf gestelltes – Leben neu aufzustellen. Als eine einfach erkennbare und leicht adaptierbare Figur des Bösen, ersetzte der Antisemit häufig den figurativen Juden, den ultimativen Anderen der europäischen Vorkriegskultur. Dennoch signalisierte diese Ersetzung weder den Wunsch, Juden in die Nachkriegsgesellschaft zu integrieren noch eine Entkräftung der weitverbreiteten und systemischen antisemitischen Vorurteile. Vielmehr im Gegensatz, hob diese Ersetzung nur noch mehr hervor, wie nach dem Holocaust geschaffene Narrative weiter auf tief verwurzelte Tropen von ‚Jewish Difference‘ aufbauten – selbst wenn sie den Antisemitismus explizit ablehnten. Die schädlichen Auswirkungen dieses figurativen Antisemitismus breiteten sich weit über Europa hinaus und dauern bis heute an.
Lisa Silverman ist außerordentliche Professorin für Geschichte und Jüdische Studien an der Universität von Wisconsin-Milwaukee. Sie erforscht die jüdische Kulturgeschichte und den Antisemitismus im modernen Mitteleuropa.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Beate Kutschke
Senior Fellow (10/2018–03/2019)
Musik und Heroismus im Kontext der Aufarbeitung des Holocaust in Österreich
 Die Heroisierung der jüdischen und nichtjüdischen Helfer und Retter sowie der überlebenden und toten Opfer der Verfolgung war ein wichtiges Element in der Bewältigung der NS-Vergangenheit nach 1945. Weltweit wurden und werden noch heute Helfer und Opfer im Holocaust als Helden gepriesen; sei es für ihren Widerstand gegen den Genozid, sei es für ihre hohe Moral im stillen Erdulden ihres Schicksals. Während Historiker, Soziologen und Psychologen auf die Bedeutung dieser Heroisierungen für die Formung moralischer Identitäten und politischer Ideologien während des Kalten Kriegs und auch danach hingewiesen haben, wurde der Rolle, die Musik bei der Heroisierung im Kontext der Aufarbeitung des Holocaust spielt, bisher keine Beachtung geschenkt. Anhand von Kompositionen, die in Bezug zum KZ Mauthausen seit den 1960er Jahren verfasst wurden – deren Musik, Libretti und Kommentare sowie die konkreten Kontexte ihrer Aufführungen –, sollen die sich ändernden Haltungen und Umgangsweisen mit dem Holocaust in Österreich beleuchtet werden, einem Land, das vergleichsweise spät begann, sich mit seiner Verstrickung in NS-Verbrechen intensiver auseinanderzusetzen.
Die Heroisierung der jüdischen und nichtjüdischen Helfer und Retter sowie der überlebenden und toten Opfer der Verfolgung war ein wichtiges Element in der Bewältigung der NS-Vergangenheit nach 1945. Weltweit wurden und werden noch heute Helfer und Opfer im Holocaust als Helden gepriesen; sei es für ihren Widerstand gegen den Genozid, sei es für ihre hohe Moral im stillen Erdulden ihres Schicksals. Während Historiker, Soziologen und Psychologen auf die Bedeutung dieser Heroisierungen für die Formung moralischer Identitäten und politischer Ideologien während des Kalten Kriegs und auch danach hingewiesen haben, wurde der Rolle, die Musik bei der Heroisierung im Kontext der Aufarbeitung des Holocaust spielt, bisher keine Beachtung geschenkt. Anhand von Kompositionen, die in Bezug zum KZ Mauthausen seit den 1960er Jahren verfasst wurden – deren Musik, Libretti und Kommentare sowie die konkreten Kontexte ihrer Aufführungen –, sollen die sich ändernden Haltungen und Umgangsweisen mit dem Holocaust in Österreich beleuchtet werden, einem Land, das vergleichsweise spät begann, sich mit seiner Verstrickung in NS-Verbrechen intensiver auseinanderzusetzen.
Beate Kutschke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Salzburg. Sie untersucht Musikgeschichte mit einer kulturwissenschaftlichen Herangehensweise. Zusätzlich zu ihren anderen Forschungsfeldern wie ‚Musik und Protest’ oder ‚computergestützte Musikanalyse’ hat sie mehrere Veröffentlichungen zu ‚Holocaust Musik’ und ‚Musik und Heroismus’ vorgelegt. Die Ergebnisse der Forschungen am VWI werden in eine Monographie einfließen.
Jacqueline Vansant
Senior Fellow (11/2017–05/2018)
Der außergewöhnliche Briefwechsel jüdisch-österreichischer Schulkameraden 1938–1953
 Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1938 stand eine Gruppe von 15- und 16-jährigen Wiener jüdischen Burschen auf einer Brücke und nahm Abschied – ‚für immer‘: Sie wussten nicht, was aus ihnen werden würde oder wohin sie das Schicksal verschlagen würde. Dennoch versprachen sie einander, dass sie alles daran setzen würden, um weiter in Kontakt zu bleiben. Dieses Versprechen führte zu einer Gruppenkorrespondenz – einem Rundbrief, wie sie es nannten –, welche sich über mehr als ein Jahrzehnt und über drei Kontinente erstrecken sollte. Dieser Bestand aus 106 Rundbriefen und 675 Einzelbriefe befindet sich seit 1994 im Grazer Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1938 stand eine Gruppe von 15- und 16-jährigen Wiener jüdischen Burschen auf einer Brücke und nahm Abschied – ‚für immer‘: Sie wussten nicht, was aus ihnen werden würde oder wohin sie das Schicksal verschlagen würde. Dennoch versprachen sie einander, dass sie alles daran setzen würden, um weiter in Kontakt zu bleiben. Dieses Versprechen führte zu einer Gruppenkorrespondenz – einem Rundbrief, wie sie es nannten –, welche sich über mehr als ein Jahrzehnt und über drei Kontinente erstrecken sollte. Dieser Bestand aus 106 Rundbriefen und 675 Einzelbriefe befindet sich seit 1994 im Grazer Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich.
Veröffentlichte Briefe zwischen Freunden dieses Alters, die ‚Anschluß‘, Exil und Anpassung an eine neue Umgebung als Jugendliche und junge Erwachsene erleben mussten, sind selten. Die geplante Edition dieses Briefwechsels wird Gelegenheit bieten, die Erfahrungen und Gedanken dieser Altersgruppe, die Herausforderungen, denen diese jungen Menschen gegenüberstanden, ihre Adoleszenz besser zu verstehen. Die – an sich schon bemerkenswerte – zeitliche Dauer des Schriftverkehrs ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, in welchem Ausmaß die verschiedenen Erfahrungen und Milieus die Burschen bzw. jungen Männer und deren Identitäten prägten.
Die Veröffentlichung der Briefe wird einen wichtigen Beitrag für Exil-, Holocaust- und Migrationsstudien leisten und zeigen, wie die Aufrechterhaltung des Kontakts innerhalb einer Peergroup mit gemeinsamem kulturellen Hintergrund half, das Trauma des Exils bzw. des Übergangs vom Exil in die Emigration zu überwinden.
Jacqueline Vansant ist Professorin für Germanistik an der University of Michigan-Dearborn. Sie hat verschiedene Publikationen zur österreichischen Literatur und Kultur nach 1945 und zum Exil vorgelegt, u.a: Against the Horizon: Feminism and Postwar Austrian Women Writers, Westport 1988, and Reclaiming ‚Heimat‘: Trauma and Mourning in Memoirs by Jewish Austrian Réemigrés, Detroit 2001. Ihre jüngste Publikation zum Thema Exil ist: Cohesive Epistolary Networks in Exile, in: Helga Schreckenberger (Ed.), Networks of Refugees from Nazi Germany: Continuities, Reorientations, and Collaborations in Exile, Amsterdam 2016, 247–261.
Fredrik Lindström
Senior Fellow (02/2018–06/2018)
Geschichte und Erinnerung im österreichischen Nachkrieg 1960–1988
 Das dem Forschungsaufenthalt zugrundeliegende, übergreifende Projekt befasst sich mit der „institutionellen Landschaft“ (Tony Judt) der Geschichtsschreibung und Erinnerungsarbeit in der Kernperiode des österreichischen Nachkriegs 1960 bis 1988. Als methodische Grundlage dient Paul Ricœurs Auseinandersetzung mit der Wechselbeziehung zwischen Geschichte als Disziplin und dem neuen Forschungsfeld der Gedächtnisstudien, ausgehend von ihrem gemeinsamen Ursprung im Zeugnis bzw. in der Repräsentation der Vergangenheit in historischen Narrativen und im öffentlichen Gedenken. Das Projekt konzentriert sich dabei auf die Frage der Ausformung des Umgangs unterschiedlicher Institutionen, wie etwa historischer Kommissionen, Forschungsinstitute und Dokumentationsarchive, mit der Vergangenheit.
Das dem Forschungsaufenthalt zugrundeliegende, übergreifende Projekt befasst sich mit der „institutionellen Landschaft“ (Tony Judt) der Geschichtsschreibung und Erinnerungsarbeit in der Kernperiode des österreichischen Nachkriegs 1960 bis 1988. Als methodische Grundlage dient Paul Ricœurs Auseinandersetzung mit der Wechselbeziehung zwischen Geschichte als Disziplin und dem neuen Forschungsfeld der Gedächtnisstudien, ausgehend von ihrem gemeinsamen Ursprung im Zeugnis bzw. in der Repräsentation der Vergangenheit in historischen Narrativen und im öffentlichen Gedenken. Das Projekt konzentriert sich dabei auf die Frage der Ausformung des Umgangs unterschiedlicher Institutionen, wie etwa historischer Kommissionen, Forschungsinstitute und Dokumentationsarchive, mit der Vergangenheit.
Im Mittelpunkt der im Frühjahr 2018 in Wien durchzuführenden Teilforschung steht das Dokumentationszenturm des Bundes Jüdischer Verfolgter des Naziregimes, das von Simon Wiesenthal von 1961 bis 2005 geleitet wurde.
Fredrik Lindström studierte Geschichte an der Universität Lund und verbrachte ein Post-Doc-Studienjahr am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Zurzeit ist er Senior Lecturer of European Studies an der Universität Malmö, wo er auch über mehrere Jahre das Doktorandenprogramm geleitet hatte.
Natan Sznaider
Senior Fellow (06/2017–08/2017)
Kontinuität und neue Perspektiven. Hannah Arendt und die Soziologie des Antisemitismus
 Hannah Arendt hat sich nicht als Soziologin einen Namen gemacht. Ganz im Gegenteil. Sie teilte die Vorurteile viele ihrer Zeitgenossinnen und -genossen der Weimarer Republik gegen die Sozialwissenschaften und gegen die Soziologie im Besonderen. Allein ein 40.000 Worte umfassendes – erst 2007 im Sammelband The Jewish Writings veröffentlichtes – Manuskript über den Antisemitismus gehört wohl zu ihren am ehesten als ‚soziologisch‘ in engerem Sinn zu bezeichnenden Schriften und unterscheidet sich grundlegend von den später von ihr veröffentlichten und besser bekannten Studien zum Thema. Die in ihrer deutschen Originalfassung bis heute nicht publizierte Arbeit entstand in Hannah Arendts Exil in Frankreich Ende der 1930er-Jahre. Der Essay beginnt mit einer historischen Analyse jüdischen Lebens in Europa und beinhaltet eine Kritik sowohl der Assimilation als auch des Zionismus. Arendt stellt dabei das Aufkommen des modernen Antisemitismus im Zusammenhang mit dem Klassenkampf zwischen der deutschen Aristokratie und dem Bürgertum, den sie mit dem aufkommenden Nationalstaat kontextualisiert. Mit der Herstellung solcher historischer Zusammenhänge weist sie auch jegliche Essentialisierung des Antisemitismus zurück.
Hannah Arendt hat sich nicht als Soziologin einen Namen gemacht. Ganz im Gegenteil. Sie teilte die Vorurteile viele ihrer Zeitgenossinnen und -genossen der Weimarer Republik gegen die Sozialwissenschaften und gegen die Soziologie im Besonderen. Allein ein 40.000 Worte umfassendes – erst 2007 im Sammelband The Jewish Writings veröffentlichtes – Manuskript über den Antisemitismus gehört wohl zu ihren am ehesten als ‚soziologisch‘ in engerem Sinn zu bezeichnenden Schriften und unterscheidet sich grundlegend von den später von ihr veröffentlichten und besser bekannten Studien zum Thema. Die in ihrer deutschen Originalfassung bis heute nicht publizierte Arbeit entstand in Hannah Arendts Exil in Frankreich Ende der 1930er-Jahre. Der Essay beginnt mit einer historischen Analyse jüdischen Lebens in Europa und beinhaltet eine Kritik sowohl der Assimilation als auch des Zionismus. Arendt stellt dabei das Aufkommen des modernen Antisemitismus im Zusammenhang mit dem Klassenkampf zwischen der deutschen Aristokratie und dem Bürgertum, den sie mit dem aufkommenden Nationalstaat kontextualisiert. Mit der Herstellung solcher historischer Zusammenhänge weist sie auch jegliche Essentialisierung des Antisemitismus zurück.
Auf einer allgemeineren Ebene kann argumentiert werden, dass die konservativen Kräfte befürchteten, dass die traditionellen Oberschichten, die gewissermaßen den Schlussstein des sozialen Gefüges bildeten, von Außenseitern durchsetzt werden, deren einziges Unterscheidungsmerkmal der Geldbesitz war. Unfähig die gesellschaftlichen Regeln von Achtung und Respekt, die den gesellschaftlichen Kitt bildeten, zu verstehen, würden diese ‚Neuankömmlinge‘ die Gesellschaft untergraben und letztlich zerstören. Diese Denkungsart und dieses Streben nach einer Vergangenheit, als persönliche Beziehungen für Authentizität gesorgt haben sollen, brandmarkt das Streben nach Geld letztlich als etwas Unauthentisches, Fremdes. Wenn die Gesellschaft als eine Einrichtung gedacht wird, die über persönliche Beziehungen zusammengehalten wird, dann kann Geld eben nur die Rolle des Agenten der Entpersonalisierung, des Agenten der Entmenschlichung zugewiesen werden. Aber trotz dieses scheinbaren Paradox‘ war es dennoch ein Leichtes, diesen vermeintlichen Agenten eben in der Person des Juden festzumachen: Die Identifikation von Juden und Geld – worüber sich ja Karl Marx in seinem Essay Zur Judenfrage den Kopf zerbrach – ist allzu bekannt.
Ausgehend von Arendts Theorie des Antisemitismus kann damit aber ein größerer Bezugsrahmen zwischen Modernität und Antisemitismus hergestellt werden.
Natan Sznaider wurde als Kind polnischer, nach dem Zweiten Weltkrieg staatenloser Shoah-Überlebender in Deutschland geboren. Als Erwachsener übersiedelte er nach Israel. Er ist Professor für Soziologie am Academic College in Tel Aviv-Yaffo. 2016 lehrte er an der Ludwig-Maximilian Universität München. Seine Forschungsschwerpunkte sind Fragen des kulturellen Gedächtnisses in Europa, Israel und Lateinamerika.
Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen zählen: Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era. The Ethics of Never Again (gemeinsam mit Alejandro Baer), London 2017; Herzl reloaded. Kein Märchen, Frankfurt/Main 2016 (gemeinsam mit Doron Rabinovici); Gedächtnisraum Europa: Die Visionen des europäischen Kosmopolitismus. Eine jüdische Perspektive, Bielefeld 2008; Holocaust and Memory in the Global Age, Philadelphia 2006; und Gesellschaften in Israel – Eine Einführung in zehn Bildern, Frankfurt/Main (in Druckvorbereitung).