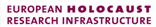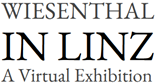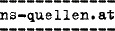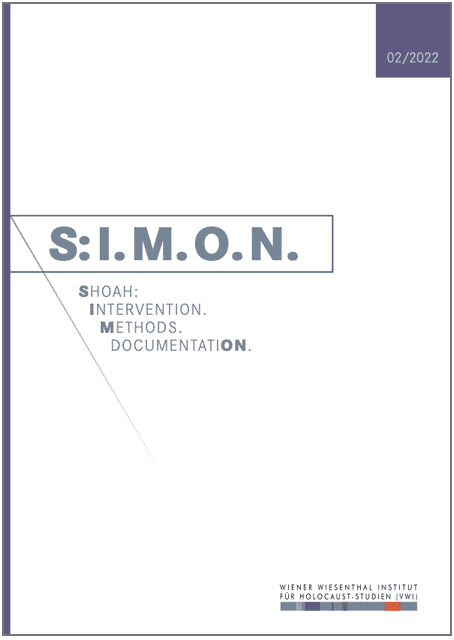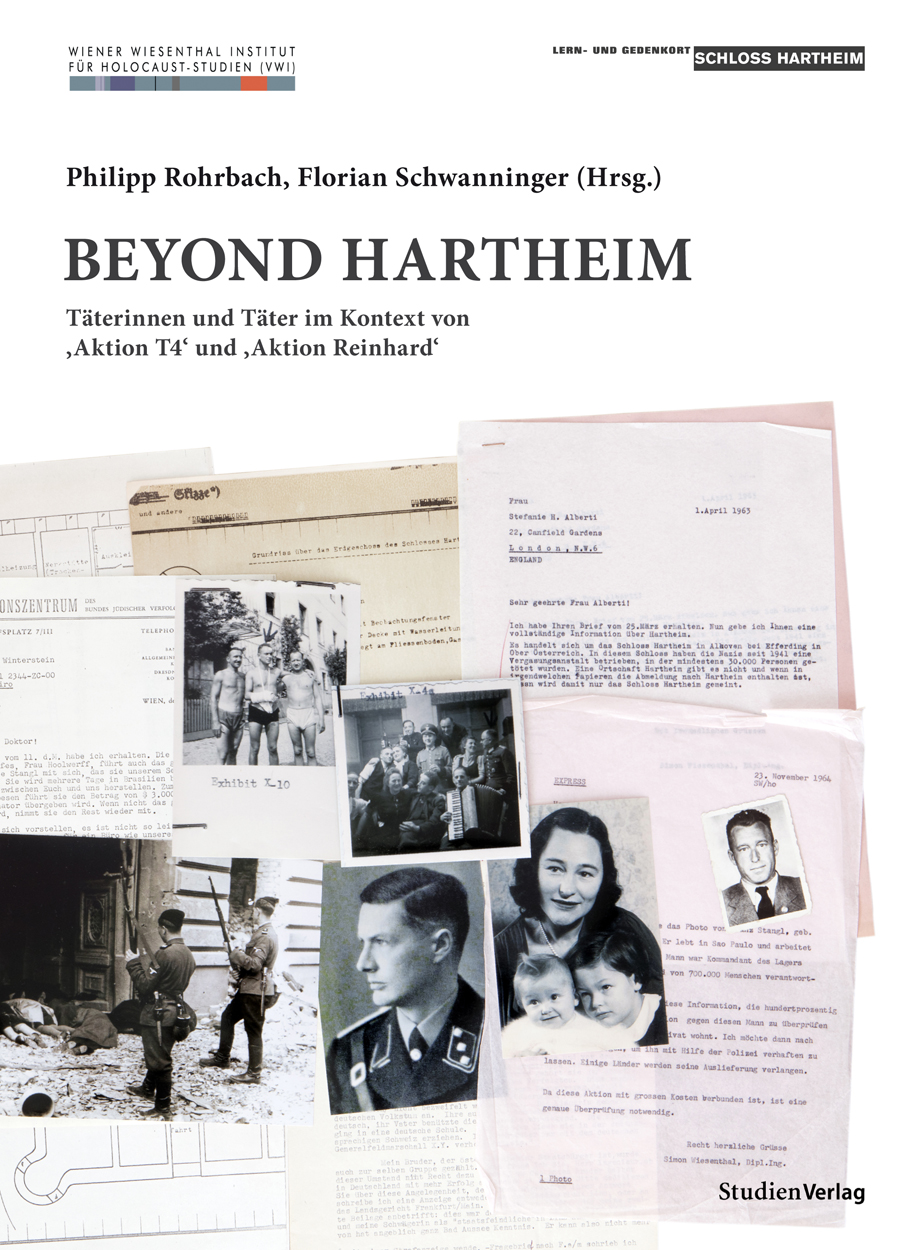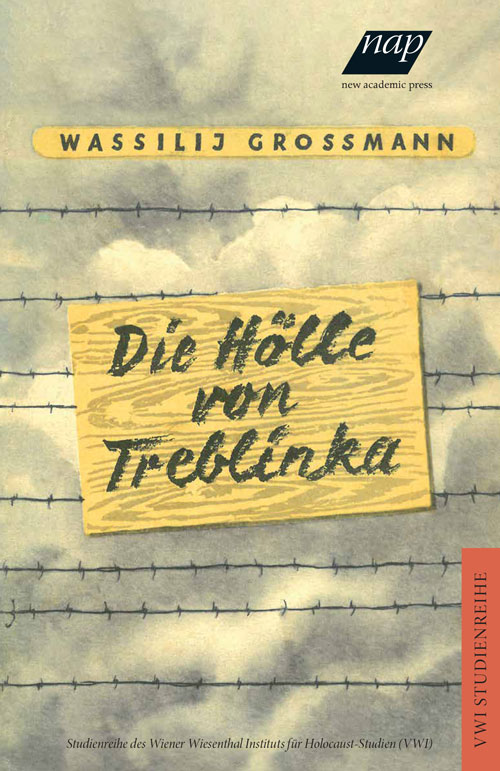News – Veranstaltungen – Calls
| 24. April 2024 19:00 BuchpräsentationIngeborg Bachmann, Marie Luise Kaschnitz, Hilde Domin, Nelly Sachs: Über Grenzen sprechend. Briefe. Piper/Suhrkamp, München, Berlin, Zürich 2023Ingeborg Bachmann stand mit zentralen Protagonistinnen der deutschsprachigen Literatur im Austausch, nun werden ihre Briefwechsel mit Marie Luise Kaschnitz, Hilde Domin und Nelly Sachs erstmals zugänglich gemacht. Die Briefe geben Einblick in die Lebensbedingungen, das literarische S...Weiterlesen... |
| 02. Mai 2024 18:30 Simon Wiesenthal LectureEdyta Gawron: Never Too Late to Remember, Never Too Late for Justice! Holocaust Research and Commemoration in Contemporary PolandIn 1994, Simon Wiesenthal received a doctorate honoris causa from the Jagiellonian University in Krakow for his lifelong quest for justice – half a century after he had been, for a short time, prisoner of the local Nazi Concentration Camp (KL) Plaszow. The 1990s were the decade when t...Weiterlesen... |
| 07. Mai 2024 00:00 - 04. Juni 2024 00:00 WorkshopDealing with Antisemitism in the Past and Present. Scientific Organisations and the State of Research in AustriaThis series of talks, presented by antisemitism experts from different organisations that research antisemitism using a variety of academic approaches, aims to provide a snapshot of historical evolutions, current events, prevalent perceptions and declared (and undeclared) attitudes. I...Weiterlesen... |
| 14. Mai 2024 08:45 - 16. Mai 2024 16:30 TagungQuantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling: What Contribution to Holocaust History? About the conference: https://quantiholocaust.sciencesconf.org/ Programme timed on the basis of 15-minute presentations + 15-minute discussions; short breaks and lunches Day 1 Tuesday, 14 May 2024Centre Malher (9 rue Malher 75004 Paris/amphi Dupuis) From 8.45 am: Welcome9.30 am...Weiterlesen... |
| 24. Mai 2024 18:00 InterventionLange Nacht der Forschung 20242024 öffnet das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) in der Langen Nacht der Forschung wieder seine Tore und lädt Interessierte in seine Räumlichkeiten am Rabensteig 3 ein. Im Rahmen von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Präsentationen bieten VWI-Team und Gäste Einb...Weiterlesen... |
Winson Chu
Senior Fellow (03/2024 – 07/2024)
Das Ghetto Lodz und die Kriminalpolizei: Jüdinnen und Juden, Nachbar:innen und Straftäter im Holocaust
 Dieses Projekt untersucht, wie lokale Angehörige der Kriminalpolizei im nationalsozialistisch besetzten Polen sich am Holocaust beteiligten und dabei ihr „Deutsch-Sein“ förderten. Ihre Ortskenntnis nutzten diese Polizisten in der Stadt Lodz dazu, ihre ehemaligen Nachbar:innen – auch solche, die sich unter den 200.000 Jüdinnen und Juden im Ghetto von Lodz befanden – zu verhaften und zu foltern. Die Untersuchung offizieller deutscher Dokumente sowie jüdischer Zeugenaussagen auf Polnisch und Jiddisch ermöglicht es, die Geschichte des Ghettos von unten zu schreiben und zu verstehen, wie einzelne jüdische Opfer auf ihre Verfolgung reagierten. Dieser Ansatz betrachtet die Geschichte des Ghettos als eine Geschichte von Kontinuitäten, sowohl räumlich als auch zeitlich, und bietet eine umfassende Darstellung des deutsch-polnisch-jüdischen Verhältnisses während des Holocaust sowie im Polen des zwanzigsten Jahrhunderts.
Dieses Projekt untersucht, wie lokale Angehörige der Kriminalpolizei im nationalsozialistisch besetzten Polen sich am Holocaust beteiligten und dabei ihr „Deutsch-Sein“ förderten. Ihre Ortskenntnis nutzten diese Polizisten in der Stadt Lodz dazu, ihre ehemaligen Nachbar:innen – auch solche, die sich unter den 200.000 Jüdinnen und Juden im Ghetto von Lodz befanden – zu verhaften und zu foltern. Die Untersuchung offizieller deutscher Dokumente sowie jüdischer Zeugenaussagen auf Polnisch und Jiddisch ermöglicht es, die Geschichte des Ghettos von unten zu schreiben und zu verstehen, wie einzelne jüdische Opfer auf ihre Verfolgung reagierten. Dieser Ansatz betrachtet die Geschichte des Ghettos als eine Geschichte von Kontinuitäten, sowohl räumlich als auch zeitlich, und bietet eine umfassende Darstellung des deutsch-polnisch-jüdischen Verhältnisses während des Holocaust sowie im Polen des zwanzigsten Jahrhunderts.
Winson Chu, außerordentlicher Professor für Neuere Mitteleuropäische Geschichte an der University of Wisconsin-Milwaukee und Autor von The German Minority in Interwar Poland. Er war Mitglied des Vorstands der Polish Studies Association, des wissenschaftlichen Beirats der Holocaust Educational Foundation der Northwestern University und des Vorstands der Central European History Society.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Constantin Iordachi
Senior Fellow (10/2023 – 02/2024)
„Säuberungen“ des Ultranationalismus: Eine vergleichende Geschichte des Faschismus in Osteuropa, 1918–1945
 Das Projekt vergleicht Spielarten des Faschismus in Osteuropa, um die faschistischen Bewegungen und Regime in dieser Region stärker in die allgemeine Faschismusforschung zu integrieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem faschistischen Streben nach gewaltsamer „Säuberung“ und der Rolle, die Faschist:innen in der Region bei der Planung und Durchführung des Holocaust spielten. Ziel des Projekts ist es, eine neue Forschungsagenda für das vergleichende Studium des Faschismus aufzustellen und somit zur Feinabstimmung oder grundlegenden Änderung der bestehenden Erklärungsansätze beizutragen. Die vergleichende Faschismusforschung soll somit – im Sinne eines Austausches und Abgleichs wissenschaftlicher Traditionen in Ost- und Westeuropa – auf neue theoretische und methodische Grundlagen gestellt werden.
Das Projekt vergleicht Spielarten des Faschismus in Osteuropa, um die faschistischen Bewegungen und Regime in dieser Region stärker in die allgemeine Faschismusforschung zu integrieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem faschistischen Streben nach gewaltsamer „Säuberung“ und der Rolle, die Faschist:innen in der Region bei der Planung und Durchführung des Holocaust spielten. Ziel des Projekts ist es, eine neue Forschungsagenda für das vergleichende Studium des Faschismus aufzustellen und somit zur Feinabstimmung oder grundlegenden Änderung der bestehenden Erklärungsansätze beizutragen. Die vergleichende Faschismusforschung soll somit – im Sinne eines Austausches und Abgleichs wissenschaftlicher Traditionen in Ost- und Westeuropa – auf neue theoretische und methodische Grundlagen gestellt werden.
Constantin Iordachi, Professor am Historischen Institut der CEU, Präsident der International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas) und Mitglied der Academia Europaea – The Academy of Europe. Mitglied des Akademischen Ausschusses des Hauses der Europäischen Geschichte, Brüssel. Iordachi ist u. a. Chefredakteur des CEU Review of Books.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Atinati Mamatsashvili
Senior Fellow (10/2023 – 04/2024)
Literatur im Angesicht des Nationalsozialismus. Die mörderischen Räume antisemitischer Politik in den 1930er und 1940er Jahren
 Das Projekt untersucht literarische Werke französischsprachiger Autor:innen im Europa der 1930er und 1940er Jahre. Es geht der Frage nach, wie sich die nationalsozialistische Ausgrenzungspolitik gegenüber den Jüdinnen und Juden in Schriften von Autor:innen manifestiert, die ab den 1930er Jahren vor den Gefahren der nationalsozialistischen Ideologie warnten und „zwischen den Zeilen“, direkt oder durch heimliche Veröffentlichungen, die Bedingungen anprangerten, denen Jüdinnen und Juden ausgesetzt waren. Die Untersuchung der Verfolgungspraxis anhand literarischer Werke stützt sich auf Fragen der Räumlichkeit, die die Begriffe „Ausgrenzung“ und „Verfolgung“ von Anfang an aufwerfen.
Das Projekt untersucht literarische Werke französischsprachiger Autor:innen im Europa der 1930er und 1940er Jahre. Es geht der Frage nach, wie sich die nationalsozialistische Ausgrenzungspolitik gegenüber den Jüdinnen und Juden in Schriften von Autor:innen manifestiert, die ab den 1930er Jahren vor den Gefahren der nationalsozialistischen Ideologie warnten und „zwischen den Zeilen“, direkt oder durch heimliche Veröffentlichungen, die Bedingungen anprangerten, denen Jüdinnen und Juden ausgesetzt waren. Die Untersuchung der Verfolgungspraxis anhand literarischer Werke stützt sich auf Fragen der Räumlichkeit, die die Begriffe „Ausgrenzung“ und „Verfolgung“ von Anfang an aufwerfen.
Atinati Mamatsashvili , Professorin für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Ilia State University in Tiflis. Forschungsschwerpunkte: Literatur und totalitäre Regime (Drittes Reich und Sowjetunion), französische und frankophone Literatur und Antisemitismus. Mitglied des Komitees der Buchreihe Comparative History of Literatures in European Languages (CHLEL).
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Senior Fellowships 2023/24 des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Senior Fellowships für das Studienjahr 2023/24 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzleramt sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich seiner Vor- und seiner Nachgeschichte.
Als Senior Fellow können sich herausragend qualifizierte, promovierte Forscher:innen bewerben, die sowohl wissenschaftliche Publikationen vorgelegt haben als auch in universitärem oder wissenschaftlich-institutionellem Bereich über langjährige Erfahrungen verfügen. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, frei einem selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holocaust-Forschung nachzugehen. Ziel des Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissenschaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Senior Fellows die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorhaben beratend unterstützen. Darüber hinaus ist die Einbindung der Senior Fellows in das Wiener Forschungsumfeld, z. B. durch Gastseminare und vorträge an akademischen Einrichtungen erwünscht. Die Senior Fellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu sein.
Projekte der Senior Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Fragestellung, Verfah-ren und Methoden stehen frei. Die Bestände des institutseigenen Archivs stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse werden im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum präsentiert. Am Ende des Aufenthalts ist ein Artikel vorzulegen, der begutachtet und im E-Journal des VWI, S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. veröffentlicht wird.
Die Dauer der Senior Fellowships beträgt mindestens fünf Monate. Senior Fellows erhalten am VWI einen Arbeitsplatz und Internetzugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt € 2.500.- monatlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten während des Aufenthalts (bis € 700.- monatlich) sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Recherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten außer Haus steht ein einmaliges Budget in der Höhe von weiteren € 500.- zur Verfügung.
Die Auswahl erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
- einem ausgefüllten Antragsformular,
- einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Projekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge)
- einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto (fakultativ).
Die Anträge sind bis 13. Jänner 2023 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusammengefasst) mit dem Betreff „VWI-Research Fellowships 2023/24“ an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu richten.
Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.
Senior Fellowships 2024/25 des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Senior Fellowships für das Studienjahr 2024/25 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom öster-reichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzler-amt sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Do-kumentation von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich sei-ner Vor- und seiner Nachgeschichte.
Als Senior Fellow können sich herausragend qualifizierte, promovierte Forscher:innen bewerben, die sowohl wissenschaftliche Publikationen vorgelegt haben als auch in universitärem oder wis-senschaftlich-institutionellem Bereich über langjährige Erfahrungen verfügen. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, frei einem selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holo-caust-Forschung nachzugehen. Ziel des Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissenschaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Senior Fellows die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorhaben beratend unterstützen. Darüber hinaus ist die Einbindung der Senior Fellows in das Wiener Forschungsumfeld, z. B. durch Gastseminare und vorträge an akademischen Einrichtungen erwünscht. Die Senior Fellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu sein.
Projekte der Senior Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Fragestellung, Verfah-ren und Methoden stehen frei. Die Bestände des institutseigenen Archivs stehen ihnen zur Ver-fügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse werden im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum präsentiert. Am Ende des Aufenthalts ist ein Artikel vorzulegen, der begutachtet und im E-Journal des VWI, S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. veröffentlicht wird.
Die Dauer der Senior Fellowships beträgt mindestens fünf Monate. Senior Fellows erhalten am VWI einen Arbeitsplatz und Internet-Zugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt € 2.500.- mo-natlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten während des Aufenthalts (bis € 600.- monatlich) sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Re-cherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten außer Haus steht ein einma-liges Budget in der Höhe von weiteren € 200.- zur Verfügung.
Die Auswahl erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
- einem ausgefüllten Antragsformular,
- einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Projekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge)
- einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto (fakultativ).
Die Anträge sind bis 12. Jänner 2024 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusam-mengefasst) mit dem Betreff „VWI-Research Fellowships 2024/25“ an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu richten.
Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.
Patrick Bernhard
Senior Fellow (09/2022 – 01/2023)
Nordafrika und der Holocaust: Eine Verflechtungsgeschichte von Nationalsozialismus und Kolonialismus
 Bis heute ist die Frage nach dem Zusammenhang von Kolonialismus und Nationalsozialismus hoch umstritten. Das Projekt stellt sich dem Problem auf neue Weise: Anstatt wie bisher üblich Vergleiche zu ziehen zwischen der deutschen Präsenz in Afrika während des Deutschen Kaiserreichs seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik in Osteuropa 40 Jahre später, soll nun die transnationale Perspektive untersucht werden; wie sich der vom NS-Staat initiierte und vorangetriebene Holocaust auf kolonialem Boden in Nordafrika abspielte, als die Region zu einem wichtigen Schauplatz des Zweiten Weltkriegs wurde und die 450.000 dort lebenden jüdischen Menschen in den Fokus der Verfolgung gerieten.
Bis heute ist die Frage nach dem Zusammenhang von Kolonialismus und Nationalsozialismus hoch umstritten. Das Projekt stellt sich dem Problem auf neue Weise: Anstatt wie bisher üblich Vergleiche zu ziehen zwischen der deutschen Präsenz in Afrika während des Deutschen Kaiserreichs seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik in Osteuropa 40 Jahre später, soll nun die transnationale Perspektive untersucht werden; wie sich der vom NS-Staat initiierte und vorangetriebene Holocaust auf kolonialem Boden in Nordafrika abspielte, als die Region zu einem wichtigen Schauplatz des Zweiten Weltkriegs wurde und die 450.000 dort lebenden jüdischen Menschen in den Fokus der Verfolgung gerieten.
Konzeptionell orientiert sich die Arbeit damit an Zugängen neuerer Arbeiten zum Holocaust in Ost- und Südosteuropa, die die Verfolgung und Ermordung der Jüdinnen und Juden vor dem Hintergrund bereits bestehender lokaler Konflikte zwischen als religiös, ethnisch oder rassisch definierten Bevölkerungsgruppen analysieren und damit in zeitlich längere Zusammenhänge einbetten.
Patrick Bernhard, Professor für Moderne Europäische Geschichte an der Universität Oslo. Zu seinen Schwerpunkten zählen unter anderem kollektive Gewalt in der Moderne, die Geschichte des Mittelmeers und das Verhältnis von Kolonialismus und Faschismus. Er publizierte zuletzt zu kolonialer Massengewalt und Judenverfolgung in Nordafrika sowie zu Nazi-Deutschland und seinen Verflechtungen mit anderen Imperien.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Andrii Bolianovskyi
Senior Fellow (03/2023 – 08/2023)
Struktureller Völkermord und die Instrumentalisierung des Antisemitismus: SS, Polizei, Sicherheitsdienste des nationalsozialistischen Deutschlands, ihre Hilfskonstruktionen und der Holocaust in der Ukraine, Juli 1941–Juli 1944
 Hauptgegenstand des Projekts sind die besatzungspolizeilichen Strukturen des nationalsozialistischen Deutschlands in der Ukraine 1941¬–1944. Besonderes Augenmerk wird auf die vergleichende Analyse des Einsatzes von Ukrainern, Russen, sogenannten Volksdeutschen und Personen anderer Nationalitäten in den Polizeistrukturen des Dritten Reichs in der nationalsozialistischen Besatzungspolitik gelegt.
Hauptgegenstand des Projekts sind die besatzungspolizeilichen Strukturen des nationalsozialistischen Deutschlands in der Ukraine 1941¬–1944. Besonderes Augenmerk wird auf die vergleichende Analyse des Einsatzes von Ukrainern, Russen, sogenannten Volksdeutschen und Personen anderer Nationalitäten in den Polizeistrukturen des Dritten Reichs in der nationalsozialistischen Besatzungspolitik gelegt.
Das Ziel der Forschung ist die Untersuchung der Organisationsstruktur, der Führung, der Anzahl, der Funktionen und der Befugnisse der deutschen Polizei und ihrer Hilfskräfte im System der Vorbereitung und Durchführung der Shoah in der Ukraine. Zahlreiche bisher unbekannte Dokumente aus Archiven der Ukraine, Deutschlands, Israels, der Vereinigten Staaten, Polens, Russlands und Österreichs werden für die Studie zum ersten Mal verwendet.
Andrii Bolianovskyi, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Iwan-Krypjakewytsch-Institut für Ukrainische Studien an der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Lviv. Er ist auf die (westliche) Ukraine, Polen, Deutschland und Russland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spezialisiert, seine Forschungsinteressen umfassen Holocauststudien, nationalistische Bewegungen, Massengewalt und Völkermord, interethnische Konflikte sowie Kriegsverbrechen.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Violeta Davoliūtė
Senior Fellow (10/2022 – 02/2023)
Der Holocaust-Täter im lokalen Gedächtnis: Fallstudien aus Litauen in europäischer Perspektive
 Der Ausbruch der kommunalen Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, der durch den deutschen Einmarsch in die UdSSR ausgelöst wurde, wurde von der Wissenschaft lange vernachlässigt. Neuere Forschung, die sich auf die Aussagen jüdischer Überlebender und auf zuvor unzugängliche sowjetische Archive stützt, haben dieses Problem zum Teil behoben. Weniger bekannt ist die Erinnerung nicht-jüdischer Augenzeug:innen und ihre Perspektive auf die lokalen, nicht-deutschen Täter:innen. Dieses Projekt nutzt noch wenig untersuchte Sammlungen audiovisueller Zeugnisse nichtjüdischer Zeug:innen der nichtdeutschen Beteiligung am Holocaust. Es wird untersucht, wie sich die lokale Erinnerung an die Täterschaft von der Zeit der fraglichen Ereignisse bis heute entwickelt hat, und zwar vor dem Hintergrund der sich verändernden Erinnerungsregime von der sowjetischen zur postsowjetischen Zeit. Diese Zeugenaussagen weichen von der kollektiven Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg als Zeit des sowjetischen Sieges oder der nationalen Viktimisierung ab und sind der Schlüssel zum Verständnis der Motivation und der Rolle dieser Täter:innen auf lokaler Ebene.
Der Ausbruch der kommunalen Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, der durch den deutschen Einmarsch in die UdSSR ausgelöst wurde, wurde von der Wissenschaft lange vernachlässigt. Neuere Forschung, die sich auf die Aussagen jüdischer Überlebender und auf zuvor unzugängliche sowjetische Archive stützt, haben dieses Problem zum Teil behoben. Weniger bekannt ist die Erinnerung nicht-jüdischer Augenzeug:innen und ihre Perspektive auf die lokalen, nicht-deutschen Täter:innen. Dieses Projekt nutzt noch wenig untersuchte Sammlungen audiovisueller Zeugnisse nichtjüdischer Zeug:innen der nichtdeutschen Beteiligung am Holocaust. Es wird untersucht, wie sich die lokale Erinnerung an die Täterschaft von der Zeit der fraglichen Ereignisse bis heute entwickelt hat, und zwar vor dem Hintergrund der sich verändernden Erinnerungsregime von der sowjetischen zur postsowjetischen Zeit. Diese Zeugenaussagen weichen von der kollektiven Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg als Zeit des sowjetischen Sieges oder der nationalen Viktimisierung ab und sind der Schlüssel zum Verständnis der Motivation und der Rolle dieser Täter:innen auf lokaler Ebene.
Violeta Davoliūtė, Professorin am Institut für Internationale Beziehungen und Politikwissenschaften der Universität Vilnius sowie Projektleiterin von Facing the Past: Public History for a Stronger Europe (Horizon Europe, 2022–2025). Als Spezialistin für kulturelles Gedächtnis und soziales Trauma hat sie zahlreiche Publikationen zu diesen Themen mit Fokus auf die baltischen Staaten und Ost-Mitteleuropa veröffentlicht.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Raz Segal
Senior Fellow (03/2023 – 07/2023)
Holocaust Bystanders: Eine Geschichte des Modernen Staates
 Das Projekt bietet eine neue Interpretation der Holocaust Bystanders in den Grenzgebieten während der ungarischen und bulgarischen Besatzungszeit, die verschiedene Gruppen ins Visier nahmen, um ethno-nationale Visionen von "Groß-Ungarn" und "Groß-Bulgarien" zu verwirklichen. Auf der Grundlage von Zeugenaussagen die zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Sprachen gesammelt wurden, wird das Projekt zeigen, wie die Angriffe des ungarischen und des bulgarischen Staates auf multiethnische und multireligiöse Gesellschaften während des Zweiten Weltkriegs das soziale Gefüge zerrissen, so dass die Bystanders in ihrem Verhalten nicht einen vorangegangenen sozialen Konflikt widerspiegelten, sondern einen, der vom gewalttätigen Staat geplant wurde. Damit soll neues Licht auf die Beziehungen zwischen Jüdinnen und Juden und ihren Nachbarn, das jüdische Leben und die jüdischen Reaktionen auf die Zerstörung vor und während des Zweiten Weltkriegs geworfen werden.
Das Projekt bietet eine neue Interpretation der Holocaust Bystanders in den Grenzgebieten während der ungarischen und bulgarischen Besatzungszeit, die verschiedene Gruppen ins Visier nahmen, um ethno-nationale Visionen von "Groß-Ungarn" und "Groß-Bulgarien" zu verwirklichen. Auf der Grundlage von Zeugenaussagen die zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Sprachen gesammelt wurden, wird das Projekt zeigen, wie die Angriffe des ungarischen und des bulgarischen Staates auf multiethnische und multireligiöse Gesellschaften während des Zweiten Weltkriegs das soziale Gefüge zerrissen, so dass die Bystanders in ihrem Verhalten nicht einen vorangegangenen sozialen Konflikt widerspiegelten, sondern einen, der vom gewalttätigen Staat geplant wurde. Damit soll neues Licht auf die Beziehungen zwischen Jüdinnen und Juden und ihren Nachbarn, das jüdische Leben und die jüdischen Reaktionen auf die Zerstörung vor und während des Zweiten Weltkriegs geworfen werden.
Raz Segal, außerordentlicher Professor für Holocaust and Genocide Studies und Stiftungsprofessor für Study of Modern Genocide an der Stockton University, wo er auch Direktor des Master-Programms Holocaust and Genocide Studies ist. Zahlreiche Veröf- fentlichungen zu den Themen Völkermord, staatliche Gewalt und Erinnerungspolitik.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Senior Fellowships 2021/2022 des Wiesenthal Institutes für Holocaust-Studien (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Senior Fellowships für das Studienjahr 2021/2022 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzleramt sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich seiner Vor- und seiner Nachgeschichte. Zudem ermuntern wir ForscherInnen aus dem Feld der Digital Humanities mit holocaustrelevanten Themen zur Bewerbung.
Als Senior Fellow können sich herausragend qualifizierte, promovierte Forscher und Forscherinnen bewerben, die sowohl wissenschaftliche Publikationen vorgelegt haben als auch in universitärem oder wissenschaftlich-institutionellem Bereich über langjährige Erfahrungen verfügen. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, frei einem selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holocaust-Forschung nachzugehen. Ziel des Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissenschaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Senior Fellows die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorhaben beratend unterstützen. Darüber hinaus ist die Einbindung der Senior Fellows in das Wiener Forschungsumfeld, z. B. durch Gastseminare und vorträge an akademischen Einrichtungen erwünscht. Die Senior Fellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu sein.
Projekte der Senior Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Fragestellung, Verfahren und Methoden stehen frei. Die Bestände des institutseigenen Archivs stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse werden im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum präsentiert. Am Ende des Aufenthalts ist ein Artikel vorzulegen, der begutachtet und im E-Journal des VWI, S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. veröffentlicht wird.
Die Dauer der Senior Fellowships beträgt mindestens sechs, maximal elf Monate. Erfahrungsgemäß sind Aufenthalte zwischen neun und elf Monaten für die wissenschaftliche Arbeit der Fellows am ergiebigsten. Senior Fellows erhalten am VWI einen Arbeitsplatz mit EDV- und Internet-Zugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt € 2.500.- monatlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten während des Aufenthalts (bis € 700.-) sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Recherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten außer Haus steht ein einmaliges Budget in der Höhe von weiteren € 500.- zur Verfügung.
Die Auswahl erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
- einem ausgefüllten Antragsformular,
- einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Projekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge)
- einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto (fakultativ).
Die Anträge sind bis 27. Jänner 2021 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusammengefasst) mit dem Betreff „VWI-Research Fellowships 2021/2022“ an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
zu richten.
Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.
Die zukünftigen Senior Fellows werden angehalten, zu versuchen, einen Teil ihrer Fellowships über ein Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Österreich zu finanzieren, und nach der Benachrichtigung über die Zuerkennung des Fellowships einen diesbezüglichen Antrag zu stellen.
Senior Fellowships 2022/2023 des Wiesenthal Institutes für Holocaust-Studien (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Senior Fellowships für das Studienjahr 2022/2023 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzleramt sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich seiner Vor- und seiner Nachgeschichte.
Als Senior Fellow können sich herausragend qualifizierte, promovierte Forscher und Forscherinnen bewerben, die sowohl wissenschaftliche Publikationen vorgelegt haben als auch in universitärem oder wissenschaftlich-institutionellem Bereich über langjährige Erfahrungen verfügen. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, frei einem selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holocaust-Forschung nachzugehen. Ziel des Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissenschaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Senior Fellows die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorhaben beratend unterstützen. Darüber hinaus ist die Einbindung der Senior Fellows in das Wiener Forschungsumfeld, z. B. durch Gastseminare und ‑vorträge an akademischen Einrichtungen erwünscht. Die Senior Fellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu sein.
Projekte der Senior Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Fragestellung, Verfahren und Methoden stehen frei. Die Bestände des institutseigenen Archivs stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse werden im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum präsentiert. Am Ende des Aufenthalts ist ein Artikel vorzulegen, der begutachtet und im E-Journal des VWI, S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. veröffentlicht wird.
Die Dauer der Senior Fellowships beträgt mindestens fünf Monate. Senior Fellows erhalten am VWI einen Arbeitsplatz und Internet-Zugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt € 2.500.- monatlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten während des Aufenthalts (bis € 700.-) sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Recherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten außer Haus steht ein einmaliges Budget in der Höhe von weiteren € 500.- zur Verfügung.
Die Auswahl erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
- einem ausgefüllten Antragsformular,
- einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Projekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge)
- einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto (fakultativ).
Die Anträge sind bis 14. Jänner 2022 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusammengefasst) mit dem Betreff „VWI-Research Fellowships 2022/2023“ an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
zu richten. Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.