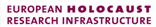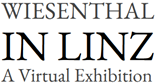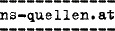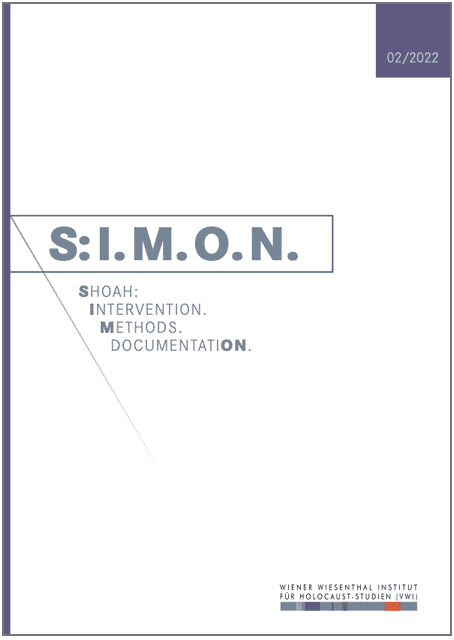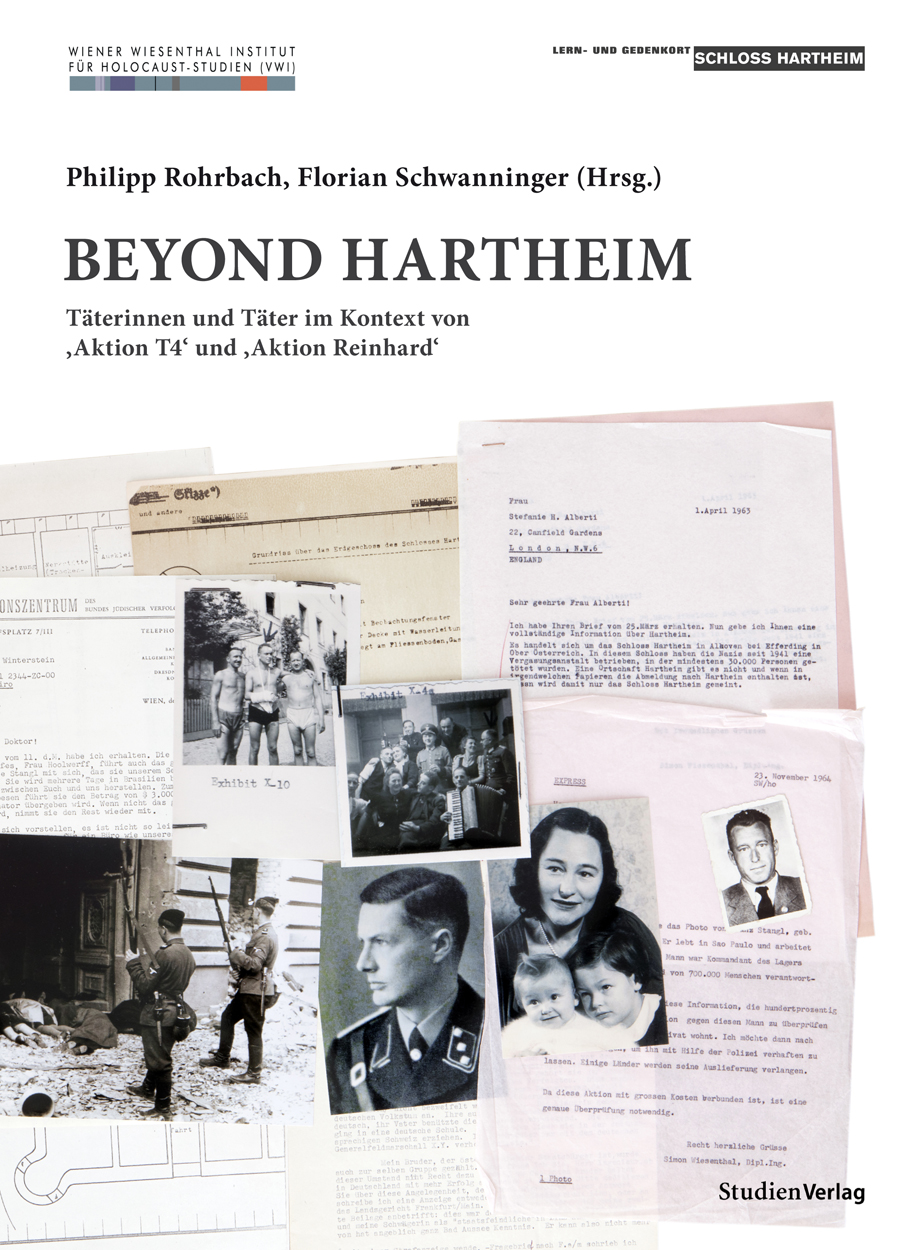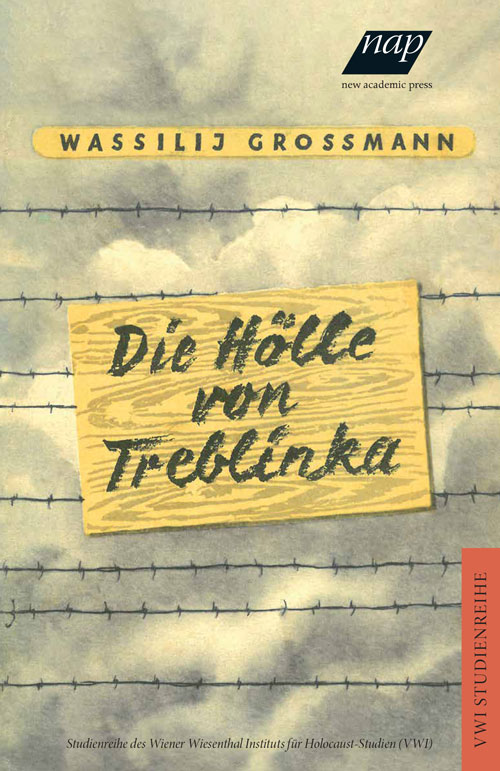News – Veranstaltungen – Calls
| 24. April 2024 19:00 BuchpräsentationIngeborg Bachmann, Marie Luise Kaschnitz, Hilde Domin, Nelly Sachs: Über Grenzen sprechend. Briefe. Piper/Suhrkamp, München, Berlin, Zürich 2023Ingeborg Bachmann stand mit zentralen Protagonistinnen der deutschsprachigen Literatur im Austausch, nun werden ihre Briefwechsel mit Marie Luise Kaschnitz, Hilde Domin und Nelly Sachs erstmals zugänglich gemacht. Die Briefe geben Einblick in die Lebensbedingungen, das literarische S...Weiterlesen... |
| 02. Mai 2024 18:30 Simon Wiesenthal LectureEdyta Gawron: Never Too Late to Remember, Never Too Late for Justice! Holocaust Research and Commemoration in Contemporary PolandIn 1994, Simon Wiesenthal received a doctorate honoris causa from the Jagiellonian University in Krakow for his lifelong quest for justice – half a century after he had been, for a short time, prisoner of the local Nazi Concentration Camp (KL) Plaszow. The 1990s were the decade when t...Weiterlesen... |
| 07. Mai 2024 00:00 - 04. Juni 2024 00:00 WorkshopDealing with Antisemitism in the Past and Present. Scientific Organisations and the State of Research in AustriaThis series of talks, presented by antisemitism experts from different organisations that research antisemitism using a variety of academic approaches, aims to provide a snapshot of historical evolutions, current events, prevalent perceptions and declared (and undeclared) attitudes. I...Weiterlesen... |
| 14. Mai 2024 08:45 - 16. Mai 2024 16:30 TagungQuantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling: What Contribution to Holocaust History? About the conference: https://quantiholocaust.sciencesconf.org/ Programme timed on the basis of 15-minute presentations + 15-minute discussions; short breaks and lunches Day 1 Tuesday, 14 May 2024Centre Malher (9 rue Malher 75004 Paris/amphi Dupuis) From 8.45 am: Welcome9.30 am...Weiterlesen... |
| 24. Mai 2024 18:00 InterventionLange Nacht der Forschung 20242024 öffnet das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) in der Langen Nacht der Forschung wieder seine Tore und lädt Interessierte in seine Räumlichkeiten am Rabensteig 3 ein. Im Rahmen von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Präsentationen bieten VWI-Team und Gäste Einb...Weiterlesen... |
| 04. Juni 2024 13:00 VWI invites/goes to...Workshop: Social History of the Shoah. Everyday Life, Space and Time VWI invites Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien 13:00Hannah Riedler (VWI Junior Fellow)Between Deportation, Forced Labour and Germanisation. The Umwandererzentralstelle in Occupied Poland 1939–1941Commented by Kerstin von Lingen 13:40Jenny Watson (VWI Research Fell...Weiterlesen... |
Vorträge und Konferenzteilnahmen der VWI-Fellows
Am 24. Oktober wird Research Fellow György Majtényi am Institut für Geschichte der Slowakischen Akademie der Wissenschaften einen Vortrag zu The Lost Revolution.The Hungarian Regime Change of 1989 in the Context of East Central European Transitions halten. Research Fellow Roland Clark wird bei der Konferenz Towards a Transnational History of Right-Wing Terrorism: New Perspectives on Political Violence and Assassinations by the Far Right in Eastern and Western Europe since 1900, die von 21. bis 23. November an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen stattffinden wird, in einem Vortrag mit dem Titel Terror and Antisemitic Student Violence in East-Central Europe, 1919-1923 sein aktuelles Forschungsprojekt zur Diskussion stellen. Das detaillierte Porgramm finden sie hier: https://www.dgo-online.org/site-dgo/assets/files/4312/right-wing_programm_i_a_red-min.pdf
Führung durch die Ausstellung über Malyj Trostenez
Im Rahmen des wissenschaftlichen Symposiums Grenzüberschreitend gedenken – Erinnerungskulturen in und über Maly Trostinec wird VWI-Archivar René Bienert am 16. Oktober um 15.30 Uhr gemeinsam mit Heidemarie Uhl (Österreichische Akademie der Wissenschaften) durch die Ausstellung Vernichtungsort Malyj Trostenez. Geschichte und Erinnerung führen und dabei den gemeinsam mit dem HdGÖ erarbeiteten Ergänzungsteil zu Österreich vorstellen.
Lehrveranstaltung "Museum and Curatorial Studies" am VWI zu Gast
Im Wintersemester 2019/20 findet das Seminar Museum and Curatorial Studies unter Leitung von Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste Wien) in Kooperation mit dem VWI statt. Das Team des Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (Éva Kovács, Béla Rásky, René Bienert und Sandro Fasching) begleitet das Seminar. Im Rahmen des Seminars finden Workshops statt (z.B. mit der Künstlerin Nina Prader), Gespräche unter anderem mit der Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek sowie Filmscreenings sind geplant. Anhand von konkreten Objekten aus dem Archiv sollen die Schnittstellen zwischen kuratorischer Praxis, wissenschaftlicher Analyse und Erinnerungs- und Trauerarbeit erkundet werden.
Von der Hoffnung auf Demokratie zu einem neuen Autoritarismus?
Die akademische Programmleiterin des VWI, Éva Kovács, wird am 11. Oktober 2019 am Symposium des Otto-Mauer-Zentrums, 1090 Wien, Währingerstraße 2-4, zum Thema "Die Repräsentation des 'ungarischen Schicksals' - Neohistorismus und Neofeudalismus in der Politik und Kultur" vortragen. Ziel der Tagung ist es, einerseits einen Rückblick auf diese Hoffnungen durch den Zusammenbruch des Stalinismus zu bieten. Andererseits soll eine nüchterne Diagnose über den gegenwärtigen Zustand der Demokratie und der politischen Kultur gestellt werden.
10. Oktober: VWI geschlossen / 10 of October: VWI closed
Am 10. Oktober 2019 ist das Institut inklusive Museum, Archiv und Bibliothek geschlossen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
The institute, including the museum, the archive, and the library will be closed on 10 of October 2019.
Thank you for your understanding.
Eine Laudatio und ein Gespräch
VWI-Geschäftsführer Béla Rásky wird anlässlich der Verleihung des 19. Theodor Kramer Preises für Schreiben im Widerstand und im Exil an Martin Pollack für Schreiben im Widerstand und im Exil an Martin Pollack am 4. Oktober 2019 in Niederhollabrunn die Laudatio halten. In Wien findet am 17.10. im Psychosozialen Zentrum ESRA um 19.30 Uhr eine Festveranstaltung mit den PreisträgerInnen statt. Am 8. Oktober 2019 wird er im Wiener Rathaus mit Bernhard Hachleitner im Rahmen der Ausstellung zu Victor Th. Slama über Das Erbe des Roten Wien? Massenfestspiele konzipiert und inszeniert von Victor Th. Slama sprechen.
VWI-Mitarbeiterin hält Vortrag im Rahmen des Modern Jewish History Seminar in Prag
Forschungsassistentin Marianne Windsperger hält am 01. Oktober 2019 am Masaryk-Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaft einen Vortrag zum Thema „The Afterlife of Yizker bikher in Contemporary Jewish Writing“.
In dem Vortrag geht sie der Frage nach, wie Formen des Erinnerns und Sammelns aus dem Medium der nach dem Holocaust entstandenen Erinnerungsbüchern, den yizker bihkern, in Texten der Gegenwartsliteratur aufgegriffen werden. Spuren dieses Sammelmediums findet man in Texten amerikanischer, deutschsprachiger, argentinischer und französischer AutorInnen.
Der neue VWI-Newsletter ist da
RÜCKBLICKE_EINBLICKE_AUSBLICKE: Der neue Newsletter VWI im Fokus 2019 ist online. Hier erfahren Sie, wer die neuen Fellows sind, zu welchen Themen sie arbeiten und welche Veranstaltungen in den nächsten Monaten bei uns am Institut stattfinden werden. Außerdem gewinnen Sie Einblicke in unser Archiv und unsere Bibliothek und können vergangene Veranstaltungen nachlesen. Heuer stellen wir in dem Interview Mahnmal der Zerstörung und Zeuge neuen jüdischen Lebens das Jüdische Historische Institut in Warschau vor.
VWI bei der Jahrestagung der AG Jüdische Sammlungen, 17.-20. September
VWI-Mitarbeiterin Marianne Windsperger wird heuer die Sammlungen und Tätigkeiten des VWI bei der Jahrestagung der AG Jüdische Sammlungen präsentieren. Die Tagung findet im Jüdischen Museum Hohenems statt, Teil des Rahmenprogramms ist ein Besuch der Ausstellung All About Tel Aviv-Jaffa und eine Führung auf den Spuren historischer Fluchtrouten. Das Programm finden Sie hier.
Schließtag
Das Institut inklusive Bibliothek, Archiv und Museum bleibt am Freitag, 16. August 2019 geschlosen.
Closed
The institute, including the library, archive and museum, will be closed on Friday, August 16, 2019.